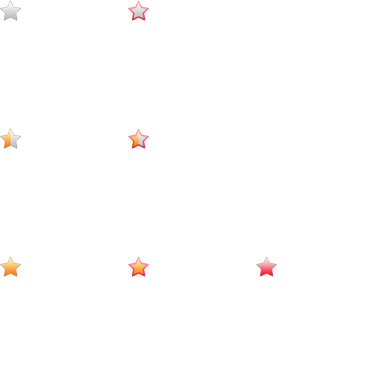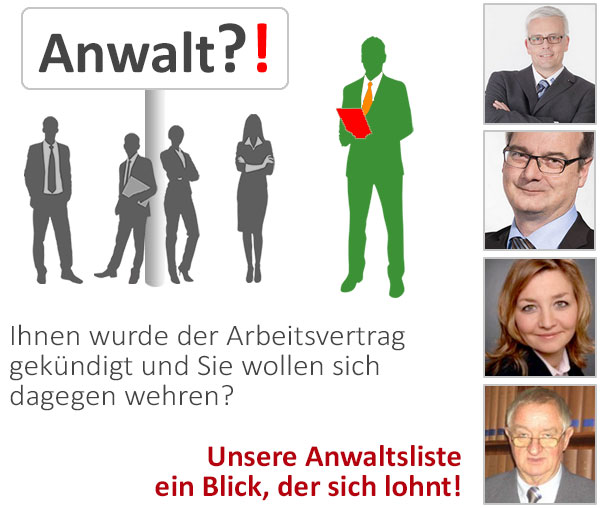Zunächst einmal muss für den von Krankheit betroffenen Arbeitnehmer einer negative Gesundheitsprognose vorliegen: D.h., dass zum Zeitpunkt der Kündigung damit zu rechnen sein muss, dass der Arbeitnehmer auch künftig wegen Krankheit seiner Arbeit nicht nachkommen kann. Dies hat – und das ist der größte Knackpunkt aus Arbeitgebersicht – der Arbeitgeber zu beweisen.
Ab Krankenstand von über sechs Wochen pro Jahr kann es Probleme geben
Grundsätzlich kommt ab einem Krankenstand von mehr als sechs Wochen pro Jahr eine negative Gesundheitsprognose in Betracht, sofern nicht von einer Änderung dieses Zustands in Zukunft auszugehen ist. Die Fehlzeiten von sechs Wochen müssen nicht am Stück entstanden sein – es kommen also grundsätzlich Arbeitsausfall aufgrund von Langzeiterkrankungen genauso in Betracht wie viele kurze Erkrankungen.
Negative Gesundheitsprognose: Beweislast liegt beim Arbeitgeber
Bei der negativen Prognose spielt also die Art der Erkrankung eine wichtige Rolle (die dem Arbeitgeber aber in vielen Fällen gar nicht bekannt ist, was aus dessen Sicht meist das Hauptproblem bei der Kündigung wegen Krankheit darstellt): So lässt beispielsweise ein einmaliger Beinbruch, der eine lange Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte, keine negative Gesundheitsprognose zu, während viele kürzere Erkrankungen aufgrund eines schlechten Immunsystems eine negative Prognose durchaus rechtfertigen können.
Arbeitsunfähigkeit und Prozessgesundung
Im Kündigungsschutzprozess kommt es deshalb teilweise zum erstaunlichen Phänomen der Prozessgesundung, bei der der Arbeitnehmer die Erkrankung, die seinen Arzt zur Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung veranlasste, herunterzuspielen.
Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen
Die zu erwartenden künftigen Fehlzeiten des betroffenen Arbeitnehmers müssen ferner die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers erheblich beeinträchtigen. Dies ist insbesondere bei Störungen des Betriebsablaufs oder erheblichen Belastungen des Arbeitgebers mit Lohnfortzahlungen der Fall.
In einem dritten Schritt wird zwischen den Interessen der Parteien abgewogen. Die Kündigung ist nur dann rechtswirksam, wenn die Interessenabwägung zugunsten des Arbeitgebers ausgeht und ihm die Beeinträchtigung seiner betrieblichen Interessen nicht zugemutet werden kann. Dabei sind Dauer des Arbeitsverhältnisses, Lebensalter des Arbeitnehmers und Krankheitsursachen zu berücksichtigen.