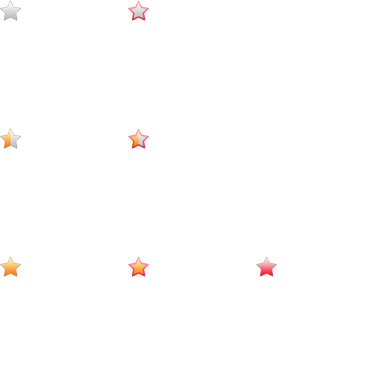Welche Rechte stehen dem Betroffenen einer Diskriminierung zu?
Nach dem AGG kann einem Beschäftigten unter bestimmten Voraussetzungen ein Beschwerderecht (§ 13 AGG), Leistungsverweigerungsrecht (§ 14 AGG) sowie ein Entschädigungs- und Schadenersatzanspruch (§ 15 AGG) zustehen.
Beschwerderecht
Nach § 13 AGG haben die Beschäftigten das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten (Bsp.: Kunden, Lieferanten, Besucher) benachteiligt fühlen. Wer als Beschäftigter gilt, ist in § 6 Abs. 1 AGG geregelt. Danach gelten auch Bewerber als Beschäftigte, so dass auch Ihnen ein Beschwerderecht zusteht. Die Beschwerde ist nicht an einer bestimmten Form oder Frist gebunden. Sie kann daher mündlich, schriftlich, per Fax oder E-Mail erhoben werden. Zu Beweiszwecken ist es aber ratsam eine schriftliche Form zu wählen.Welche Stelle für die Entgegennahme der Beschwerde zuständig ist, kann der Arbeitgeber selbst regeln. Ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gibt es dabei nicht (Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 21.07.2009, Az. 1 ABR 42/08). Es wird sich aber wohl nur um eine betriebliche und nicht um eine externe Stelle handeln dürfen.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet die Beschwerde zu prüfen und das Ergebnis mitzuteilen (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AGG). Im Rahmen der Prüfung muss der Arbeitgeber den Sachverhalt von Amtswegen umfassend aufklären. Die Mitteilung des Ergebnisses ist an keiner Form gebunden und kann daher mündlich sowie schriftlich erfolgen.
Weigert sich der Arbeitgeber eine Beschwerde entgegenzunehmen oder zu prüfen, so kann der Beschäftigte Klage erheben. Dadurch kann der Arbeitgeber gezwungen werden die Beschwerde entgegenzunehmen, zu prüfen und darüber zu entscheiden.
Ist die Beschwerde begründet hat der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 1 AGG die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.
Leistungsverweigerungsrecht
Nach § 14 AGG kann ein Beschäftigter seine Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einstellen, wenn der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ergreift und soweit die Leistungsverweigerung zum Schutz des Beschäftigten erforderlich ist. Nicht erforderlich ist, dass es bereits zu einer Belästigung gekommen ist. Vielmehr genügt die Gefahr einer solchen Diskriminierung. Unerheblich ist außerdem, ob der Arbeitgeber von der Belästigung Kenntnis hat. Ihm muss aber die Möglichkeit eingeräumt werden, auf die Belästigung zu reagieren und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.Obwohl die Vorschrift dies selbst nicht voraussetzt, wird vom Beschäftigen zu verlangen sein, dass er gegenüber seinem Arbeitgeber die Arbeitsverweigerung erklärt. Nur so kann der Arbeitgeber erkennen, warum der Beschäftigte seine Tätigkeit einstellt und entsprechend darauf reagieren.
Zu beachten ist, dass die Leistungsverweigerung für den Beschäftigten gefährlich sein kann. Denn der Arbeitgeber kann das Vorliegen einer Belästigung abstreiten und somit von einer unberechtigten Arbeitsverweigerung ausgehen. Dies kann zur Folge haben, dass der Arbeitgeber die Gehaltszahlung einstellt, eine Abmahnung ausspricht oder das Arbeitsverhältnis sogar kündigt.
Schadenersatzanspruch
Einem Beschäftigtem kann nach § 15 Abs. 1 AGG ein Anspruch auf Schadenersatz gegen seinen Arbeitgeber zustehen, wenn jemand gegen das Benachteiligungsverbot verstößt und der Beschäftigte dadurch einen Vermögensschaden erleidet. Der Verstoß kann dabei nicht nur durch ein Handeln, sondern auch durch ein Unterlassen geschehen. Nicht erforderlich ist zudem, dass durch die Benachteiligung das Persönlichkeitsrecht des Opfers verletzt wurde oder eine Herabwürdigung vorliegt.Zwar kann nach dem Wortlaut der Vorschrift jeder gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen und damit eine Haftung des Arbeitgebers auslösen. Dieses weitgehende Haftungsrisiko des Arbeitgebers wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass der Arbeitgeber den Verstoß zu verschulden haben muss. Trägt er keine Schuld an den Verstoß, kann er auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Zu beachten ist aber, dass er für das Verhalten seiner Erfüllungsgehilfen, wie zum Beispiel Vorgesetzten, einstehen muss.
Entschädigungsanspruch
Unter bestimmten Umständen kann im Fall einer Diskriminierung nach § 15 Abs. 2 AGG ein Anspruch auf eine Entschädigung im Sinne eines Schmerzensgelds bestehen. Auf ein Verschulden des Abreitgebers kommt es dabei nicht an. Zweck der Entschädigung ist der Ausgleich für das erlittene Unrecht und ein Abschreckungseffekt.In welcher Höhe der Entschädigungsanspruch besteht, liegt im Ermessen des Gerichts. Folgende Kriterien sind bei der Bemessung maßgeblich: Art und Schwere, Dauer, Anlass und Beweggrund sowie Folgen der Benachteiligung. Ferner spielt der Grad der Verantwortung des Arbeitgebers, eine eventuelle Wiedergutmachungen sowie eine Wiederholungsgefahr eine Rolle.
Besteht ein Anspruch auf Einstellung?
Kommt es im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens zu einer Benachteiligung, so steht dem Bewerber aufgrund dessen kein Anspruch auf Einstellung zu. Geregelt ist dies in § 15 Abs. 6 AGG. Durch die Regelung soll vermieden werden, dass dem Arbeitgeber ein Bewerber aufgedrängt wird. Andersherum wird der Bewerber davor geschützt für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der ihn diskriminiert hatte.
Wer hat das Vorliegen einer Benachteiligung darzulegen und ggf. zu beweisen?
Nach § 22 AGG muss ein Betroffener nur Indizien vortragen und gegebenenfalls beweisen, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen. Gelingt ihm das, trägt wiederum der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.
Welche Fristen sind bei der Geltendmachung der Rechte zu beachten?
Bei der Geltendmachung des Beschwerde- und Leistungsverweigerungsrecht sind keine Fristen zu beachten. Wer hingegen einen Schadensersatz- oder Entschädigungsanspruch geltend macht, muss die Frist und Form des § 15 Abs. 4 AGG einhalten. Danach sind die Ansprüche innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend zu machen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn sich aus einem Tarifvertrag etwas anderes ergibt. Durch einen solchen Vertrag kann die Frist entweder verkürzt oder verlängert werden. Der Betroffene ist zudem nicht verpflichtet, den Anspruch zu beziffern.
Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.
Zudem ist die in § 61b Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes geregelte Klagefrist von drei Monaten zu beachten. Danach muss eine Klage auf Schadenersatz oder Entschädigung innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, erhoben werden.