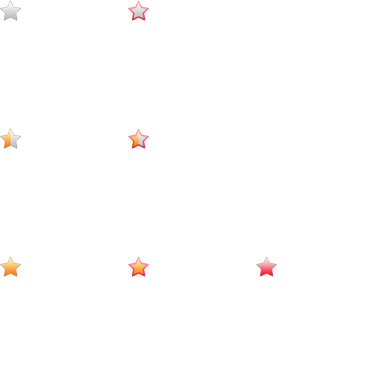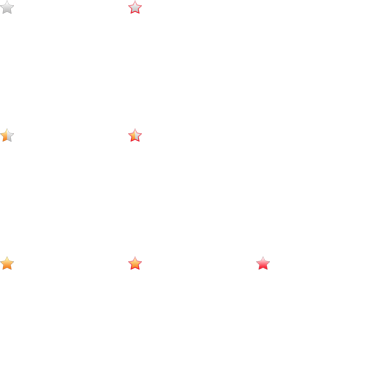Der Unterschied zwischen Schriftform und Textform ist einfach erklärt. Kurz gesagt: Für die Schriftform bedarf es einer eigenhändigen Unterschrift, während bei der Textform ein einfaches, nicht unterschriebenes Schriftstück ausreicht – beispielsweise eine E-Mail.
Die Textform
Das Gesetz nennt in § 126 b BGB die Textform als „lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist“ und die „auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben“ wird. Damit ist die Textform die gesetzliche Form mit den geringsten Anforderungen. Sie kann durch einfache schriftliche Erklärung per (maschinell erstelltem) Brief auf Papier, per Telefax, E-Mail, SMS, Whatsapp-Nachricht oder sonstiger elektronischer Nachrichten erfolgen. Es bedarf keiner eigenhändigen Unterschrift oder elektronischen Signatur. Es genügt, dass die Nachricht den Namen des Erklärenden enthält.
Die Schriftform
Die Schriftform ist etwas strenger. Sie muss gemäß § 126 BGB „eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden“. Dies soll dem Schriftstück eine gewisse Beweis- und Identifikationsfunktion verleihen, da mit der Unterschrift kenntlich gemacht wird, wer die Erklärung ausgestellt hat. Anhand der Unterschrift kann in Zweifelsfällen nachvollzogen werden, ob das Schriftstück tatsächlich von der als Aussteller bezeichneten Person erstellt wurde. Die Erklärung im Namen einer anderen Person wird dadurch zumindest erschwert.
Die elektronische Form
Die Schriftform kann durch elektronische Form ersetzt werden. An die Stelle der eigenhändigen Unterschrift tritt dann gemäß § 126 a BGB die dem elektronischen Dokument hinzuzufügende „qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz“.
Öffentliche Beglaubigung und notarielle Beurkundung
Neben Textform, Schriftform und elektronischer Form nennt das Gesetz noch die öffentliche Beglaubigung gemäß § 129 BGB und die notarielle Beurkundung gemäß § 128 BGB für besonders formbedürftige Geschäfte wie beispielsweise Kaufverträge über Grundstücke. Für das Testament gilt die besondere Formvorschrift des § 2247 BGB, wonach das eigenhändige Testament vollständig handschriftlich aufgeschrieben und eigenhändig unterschrieben werden muss.
Gesetzliche Formvorschriften
Formvorschriften müssen dann eingehalten werden, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind oder wenn sie wirksam zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurden.
Die Schriftform wird in einer Vielzahl von Fällen gesetzlich verlangt: Dazu gehören u.a. die Ausstellung von Quittungen, Verbraucherdarlehensverträge, Kündigung des Arbeitsvertrags sowie Kündigung des Mietvertrags, Bürgschaften und Pflegeverträge.
Vertraglich vereinbarte Form
Soll eine besondere Form vertraglich vereinbart werden, ist immer zu prüfen, ob dies rechtlich zulässig ist. Grundsätzlich kann die Schriftform vertraglich vereinbart werden. Jedoch ist bei Verbraucherverträgen darauf zu achten, dass keine zu strenge Form verlangt wird, da dies im Fall der Unwirksamkeit dazu führt, dass die gesamte Klausel nichtig ist und dann die einfache Textform ausreicht. Eine strengere Form als die Schriftform ist in Verbraucherverträgen in der Regel wegen Verstoßes gegen die Regeln zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in § 309 Nr. 13 BGB unwirksam.
Update: Ab 01.10.2016 gelten erleichterte Formvorschriften für Verbraucher
Seit dem 01.10.2016 ist eine Änderung des AGB-Rechts in Kraft, wonach Unternehmer ihren Kunden, sofern sie Verbraucher sind, für Erklärungen keine strengere Form als die einfache Textform auferlegen dürfen. Bei Verträgen, für die eine notarielle Beglaubigung vorgeschrieben wird, darf für Erklärungen keine strengere Form als die Schriftform vereinbart werden. Diese gesetzliche Neuerung bestätigt die Rechtsprechung, die in einigen jüngeren Entscheidungen bereits zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist.
Verbraucherschutz beschränkt vertragliche Formvorschriften
So hat das Oberlandesgericht München bereits mit Urteil vom 09.10.2014 (Az. 29 U 857/14) entschieden, dass die in einem eDating-Vertrag ausgeschlossene elektronische Form unwirksam ist. Denn damit sei die gesetzlich vorgesehene Schriftform, zu der auch die elektronische Form mit der elektronischen Signatur gehört, unrechtmäßig eingeschränkt worden. Dies verstoße gegen die Verbraucherschutzvorschrift des § 309 Nr. 13 BGB und führe zur Unwirksamkeit der gesamten Vertragsklausel, was in dem dem Gericht vorgelegten Fall dazu führte, dass die einfache Textform ausreichend war und der eDating-Vertrag per einfacher E-Mail gekündigt werden konnte.
§ 309 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
13. (Form von Anzeigen und Erklärungen)
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, gebunden werden
a) an eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den durch Gesetz notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist oder
b) an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a genannten Verträgen oder
c) an besondere Zugangserfordernisse;