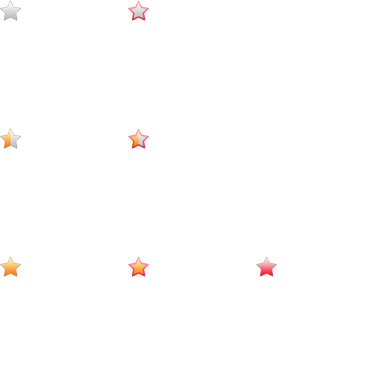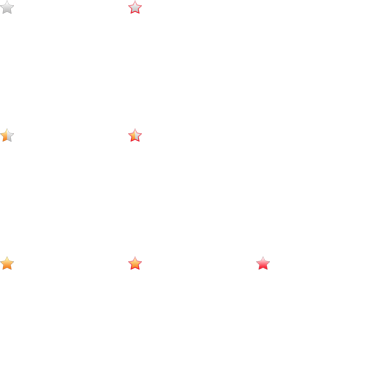Schwarzarbeit
Viele Fotografen geben sich der Illusion hin, dass das Erstellen ihrer Werke durchaus auch bezahlt werden kann. Entweder in monetärer Form oder durch Sach- bzw. Gefälligkeitsleistungen. Fotografie ist jedoch in der Tat eine Arbeit wie jede andere und wenn diese per Definition mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird, sprich dafür eine Entlohnung entgegengenommen wird, greifen alle Regeln der Schwarzarbeit.
Um des deutlich zu unterstreichen: Man darf dem Kollegen einen Gefallen tun und auf dessen Hochzeit fotografieren und sich dafür auf der Feier den Bauch vollschlagen, man darf von Wildfremden Freundschaftsfotos anfertigen und sich die Anfahrt bezahlen lassen – bloß eben ohne eine auf Gewinn abzielende Bezahlung. Sobald Geld fließt, das über das zur reinen Kostendeckung notwendige hinausgeht, muss eine (Klein-)Gewerbeanmeldung erfolgen.
 Bildrechte, Verwendungsrechte, Persönlichkeitsrechte. Bei Fotografie trifft alles aufeinander – ein rechtliches Haifischbecken. Foto: fotolia.com © Syda Productions
Bildrechte, Verwendungsrechte, Persönlichkeitsrechte. Bei Fotografie trifft alles aufeinander – ein rechtliches Haifischbecken. Foto: fotolia.com © Syda Productions
Bildrechte
Die Rechte am eigenen Bild sind das Schwerwiegendste, was ein Fotograf (und auch eventuelle Models) beachten müssen. Grundsätzlich jeder Fotograf sollte, bevor er Auftragsarbeiten annimmt, einen Vertrag abschließen. Um welchen Vertrag es sich handelt, hängt von der Form des Fotoshootings ab.
1)
Um bei der einfachsten Form der Fotografie anzufangen, ist das die sogenannte TFP-Fotografie, die Abkürzung steht für „Time for Prints“, ein Model lässt sich also fotografieren, als Entlohnung erhält sie die fertig bearbeiteten Bilder. Beim Fotograf verbleiben dabei alle Rohfotos, sprich Negative oder RAW-Dateien und er darf die Bilder bearbeiten und zur Eigenwerbung verwenden, jedoch nicht für kommerzielle Absichten. Das Model bekommt neben den Bildern auch die Nutzungsrechte selbiger, wobei die meisten Musterverträge ebenfalls einen Passus enthalten, der eine gewerbliche Nutzung der Fotos ausschließt. Diese Form der Fotografie ist gerade im Hobby-Bereich eine sehr gängige Variante, von der beide Seiten in ihrer jeweiligen Freizeitgestaltung profitieren.
Praxisbeispiel: Eine Frau lässt eine befreundete Hobbyfotografin von sich Bilder machen, um sie ihrem Ehemann zu schenken. Die Fotografin kann dem künstlerischen Schaffen nachgehen und die Bilder auf ihrer Facebook-Seite zeigen, das Model bekommt die Fotos und kann diese ebenfalls im Web zeigen und verschenken.
2)
Die nächste Variante sind sogenannte Pay- (also bezahlte) Shootings. Zwar fließt hier in jedem Fall Geld, jedoch ist nur eine der beiden Pay-Shooting-Formen nur für Fotografen mit Gewerbe offen:
- In der ersten Variante bezahlt der Fotograf ein Model dafür, dass er es nach seinen Wünschen ablichten darf. Durch die Bezahlung tritt das Model sämtliche Rechte an den Bildern ab, der Fotograf kann diese nach Belieben verwenden und verändern.
- In der zweiten Variante wird der Fotograf dafür finanziell entlohnt, Fotos anzufertigen. Normalerweise gehen in diesem Fall die Bildnutzungsrechte auf denjenigen über, der den Auftrag erteilt hat, anderslautende Übereinkünfte müssen schriftlich festgehalten werden.
Dieses zweite Beispiel zeigt bereits auch sehr schön die konträren Ebenen der Bildrechtsproblematik: Jede fotografierte Person hat ein Recht am eigenen Bild. Dieses Recht gilt nur nicht wenn die Motive:
- Die Person bei Versammlungen in der Masse zu sehen ist
- Sie eine öffentliche oder Person der Zeitgeschichte ist
- Die Person nur als Beiwerk im Motiv zu erkennen ist (etwa bei der Landschaftsfotografie)
- Die Bilder dem höheren Interesse der Kunst gelten
In allen anderen Fällen muss vor dem Fotografieren und Veröffentlichen eine Einverständniserklärung eingeholt werden. Andersherum liegen jedoch sämtliche Nutzungsrechte der erstellten Fotos bei demjenigen, der die Bilder geschossen hat. Genau wegen dieser Diskrepanz kann auch im Hobbybereich nicht genug betont werden, wie wichtig das schriftliche Festhalten aller Vereinbarungen ist. Wenn ein Model verlangt, dass der Fotograf genau zwei Bilder des Shootings auf seiner Webseite, aber nicht auf anderen Fotografenportalen veröffentlicht, dann muss dies haargenau so vertraglich festgehalten werden. Ebenso muss genau geklärt werden, wer was wo hochladen darf – denn gerade die „Rechtsklick-Speichern“-Mentalität des Internets kann sonst rasend schnell zu Verstimmungen führen.
In jedem Fall empfiehlt es sich, dabei einen sogenannten Model-Release-Vertrag zu verwenden. Dieser sollte folgendes enthalten:
- Name, Anschrift von Auftraggeber und –nehmer
- Art und Umfang des Fotoshootings
- Klärung der Rechtslage: Welche Partei bekommt was, welche Partei darf die Fotos für welche Zwecke verwenden?
- Details der Vergütung
Damit sind alle relevanten Punkte rechtssicher abgeklärt. Allerdings empfiehlt es sich dringend, für einen solchen Mustervertrag an einen Anwalt zu wenden und nicht auf die diversen, im Internet kursierenden Vordrucke zurückzugreifen, die oft eklatante Lücken aufweisen.
Panoramafreiheit
Ein weiterer kritischer Aspekt, der vor allem Hobby- und Kunstfotografen betrifft, ist das Fotografieren in der Öffentlichkeit. Denn längst nicht alles, was in der Öffentlichkeit steht, darf auch fotografiert werden. Eine recht präzise Regelung, die in § 59 des UrhG festgelegt wurde, bietet die sogenannte Panoramafreiheit. Sie besagt (stark verkürzt), dass jedermann Dinge fotografieren kann, die von öffentlich zugänglichen Wegen aus ohne Hilfsmittel (Leitern) fotografiert werden können. Ein BGH-Urteil (19.1.2017 I ZR 242/15) erlaubt auch die kommerzielle Nutzung solcher Fotos.
Doch was bedeutet das in der Praxis?
- Ein Fotograf schießt ein Foto von der Elbphilharmonie von einer frei zugänglichen Stelle des Hamburger Hafens aus, um damit einen Bildband über zeitgenössische Architektur zu füllen und zu verkaufen – nach dem neuesten Urteil erlaubt.
- Ein Privatmensch möchte wissen, wie es hinter dem Sichtschutzzaun einer Baustelle aussieht. Er fotografiert kurzerhand darüber hinweg und stellt dieses Foto auf seinen Facebook-Account. Verboten, denn der Zaun ist, auch wenn er nicht so hoch ist, dass man keine Kamera darüber halten könnte, dennoch ein Schutz vor dem öffentlichen Blick.
- Ein Interessent fotografiert vom Balkon einer Wohnung, die er anmieten möchte, ein Straßenpanorama, um es seinem Partner zu zeigen – verboten. Denn auch diese, mehreren Interessenten offenstehende Wohnung ist kein Teil des öffentlichen Raumes. Was aus ihrer Sicht gesehen wird, kann sich dramatisch von der „Öffentlichkeitsperspektive“ unterscheiden.
Das oben zitierte Urteil erlaubt zudem auch eine Bearbeitung von Bildern, die im Zuge der Panoramafreiheit geschossen wurden. So könnte ein Fotograf beispielsweise ein Auftragsgraffiti auf einer Hauswand ablichten – steht dieses Haus zur Straße hin, wäre schon das rechtlich kein Problem. Darüber hinaus darf er nach dem Urteil auch das Graffiti so freistellen, dass nicht mehr zu erkennen ist, wo es sich befindet.
Sonderfall Minderjährigkeit
Eine spezielle Position nehmen fotografierte Personen ein, die klar erkennbar noch nicht volljährig sind. Dabei gilt altersübergreifend die Tatsache, dass auch Minderjährige ein Recht am eigenen Bild haben. Aufgrund der nichtvorhandenen Geschäftsfähigkeit von Kindern unter sieben Jahren wird dieses Recht von den Erziehungsberechtigten ausgeübt. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 ist sowohl das Kind als auch die Erziehungsberechtigten zu befragen.
An dieser Stelle ein grundsätzlicher Verhaltenstipp: Für Kinder gelten die gleichen Ausnahmen von den Bildrechten, wie sie oben genannt wurden, etwa bei öffentlichen Veranstaltungen etc. Sprich, de jure wäre der Fotograf nicht verpflichtet, eine Erlaubnis einzuholen. Doch aufgrund der Tatsache, dass die gesamte Minderjährigen-Thematik ein sehr heißes Eisen ist, kann man nur empfehlen, im Zweifelsfall immer eine Einverständniserklärung einzuholen, bevor man auf den Auslöser drückt.
Zudem sei Auftragsfotografen, sowohl geschäftlich als auch im Hobbybereich, dringend ans Herz gelegt, sich niemals auf mündliche Alterszusagen zu verlassen, sondern sich immer einen rechtlich gültigen Altersnachweis (Personalausweis) zeigen zu lassen und diesen in Kopie mit Unterschrift des Models sowie der Einverständniserklärung (auch der Erziehungsberechtigten) zum Vertrag hinzuzufügen.
Fazit
Fotografie ist heute für Rechtsunkundige ein Dschungel voller Fallgruben und Stolpersteine. Gerade weil es so viele Ausnahmen gibt, lassen sich kaum pauschal gültige Aussagen treffen – bis auf eine: Alles kann vertraglich vereinbart werden. Und weil es hier um Persönlichkeitsrechte geht, die im Streitfall vor einem Gericht immer schwerer wiegen, als Kunstfreiheit etc., sei dringend empfohlen, selbst im Hobbybereich allergrößte Sorgfalt beim Erstellen solcher Verträge walten zu lassen.
Anwalt für Fotorecht
Bei weiteren rechtlichen Fragen sollten Sie sich am besten an einen Anwalt für Fotorecht wenden oder Sie suchen hier im Deutschen Anwaltsregister (DAWR) nach Anwalt Fotorecht.